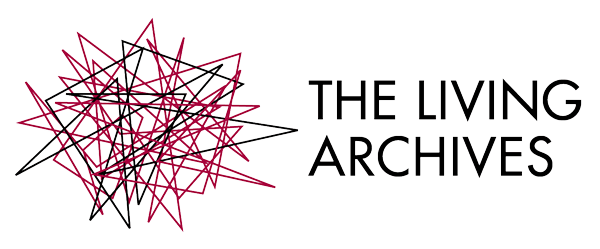(Neue) Formen der basispolitischen Arbeit
Ein Gespräch mit: Moshtari Hilal, Zuher Jazmati, Saboura Naqshband, Rena Onat
Moshtari Hilal: Basispolitische Arbeit… Ich habe Ehrfurcht vor diesem Begriff und begreife meine Arbeit weniger als basispolitische, sondern eher als künstlerische Arbeit, die sich gelegentlich politisch äußert. Meine Praxis ist stark von kollektivem Aushandeln informiert, vom Im-Raum-Kommunizieren und von Community. Aber inwiefern kann das als Künstlerin auch ein Ballast sein? Wie kann ich meine Arbeit zeigen und nicht permanent die Stimme für eine größere Gruppe sein? Wie kann ich nicht ständig repräsentieren?
Zuher Jazmati: Für mich bedeutet (basis)politische Arbeit, überhaupt erst einmal Stimmen zu hören – und dann speziell noch einmal marginalisierte Stimmen, die in der stattfindenden politischen Arbeit ansonsten nicht zu Wort kommen. Das hat zum einen mit den Intersektionen von unterschiedlich marginalisierten Stimmen zu tun; zum anderen auch mit der Frage, wie politisches Handeln noch mal neu oder anders zu denken ist.
Saboura Naqshband: Ich finde es spannend, neue Formen zu finden, um politische Diskurse zu bedienen oder zu intervenieren oder neu zu gestalten, indem die Gruppen oder die Menschen, die man erreichen will, durch andere Medien und auf anderen Ebenen ästhetisch oder über den Körper / die Sinne angesprochen werden. Es sollte die Seele und auch die politische Einstellung, die eigene Haltung inspirieren und motivieren. Es sollte den Ansporn bieten, Dinge mit einem anderen Blick zu sehen.
Viele Aktivist*innen der älteren Generation waren noch in Vereinen organisiert und haben ehrenamtlich jahrzehntelang eine krasse politische Arbeit geleistet: Leute mobilisieren, Übersetzen, Papierkram, Recherchen, juristische Verfahren anleiern, Demos… Die neue Generation macht viel über Facebook oder über WhatsApp-Gruppen. Das ist eine ganz andere Form der Aushandlung oder des Zusammenkommens, manchmal gar nicht physisch. Die Digitalisierung der politischen Arbeit ist schon etwas, das sich da beobachten lässt. Trotzdem: Wie nah wir an der Basis sind, ist immer noch davon bestimmt, wie wir organisiert sind, wie wir sprechen und worüber wir sprechen.
Rena Onat: Hier geht es um zweierlei: um die Frage nach so etwas wie Netzaktivismus und um die Frage nach politischer Kunst. Was lässt sich als ›basispolitisch‹ und was als ›Aktivismus‹ bezeichnen? Ich mache da eher so etwas wie Forschung und akademische Wissensvermittlung, die ausgeht von einer Community-basierten Kritik. Deshalb interessieren mich die Fragen, was BPoC-Wissen ausmacht, wo wir es finden und ob Kunst ein Mittel sein kann, ein solches Wissen dort zu verorten, wo es nicht vorkommt. Das wäre dann aber keine neue Form von basispolitischem Aktivismus, sondern eher eine, die mit neuen Formaten arbeitet.
Zuher Jazmati: Ich komme aus dem Click-Activism und habe meine Gedanken – nehmen wir das Beispiel Arabischer Frühling – auf Facebook geteilt. Als ich gesehen habe, wie viel von dem geliked und geteilt wurde, bekam ich einen Endorphin-Überschuss! Plötzlich hatten wir eine Community mit mehreren tausend Friends. Ob sie das, was ich sage, lesen oder hören, ob sie es verstehen oder nicht verstehen, weiß ich nicht. Sie teilen es aber, und dadurch wird neues Wissen generiert. Was wir posten, wird von Menschen gelesen und hat einen Effekt. Vielleicht gibt ihnen das eine neue Perspektive; vielleicht können sie es in ihrer Multiplikator*innen-Funktion auf ihr reales Leben übertragen; vielleicht definiert sich dadurch auch Community-Arbeit noch mal neu. Auf jeden Fall ist es interessant, wie Vernetzung durch die Digitalisierung stattfindet.
Moshtari Hilal: Ich erinnere mich, dass es auf Instagram eine Zeit gab, in der man nicht darauf wartete, repräsentiert oder angesprochen zu werden, sondern sich permanent selbst in eine Öffentlichkeit hineingeschrieben hat und sichtbar wurde. Das ist, vermutlich auch wegen veränderter Algorithmen, mittlerweile viel schwieriger. Daher wäre eine Suche nach neuen Plattformen interessant. Die Frage, die bleibt: Wie kann man für Künstler*innen, die sich der politischen Arbeit annehmen, Räume schaffen, in denen ihre Kunst respektiert wird?
Rena Onat: Mich beschäftigt der Gedanke, dass Kunst ein alternatives Archiv sein kann. Gleichzeitig gibt es so etwas wie flüchtige Archive, die in Dingen überlebt haben, uns aber vielleicht nicht so geläufig sind. Bestimmte strukturelle Gewaltformen, wie z.B. Kolonialismus oder Heteronormativität, führ(t)en dazu, dass marginalisierte Communitys unser Wissen nicht überliefern können oder es ausgelöscht wird. Wenn wir heute versuchen, uns unser Wissen und unsere Geschichten selbst wieder zugänglich zu machen, müssen wir es erst einmal schaffen, die dazugehörigen Codes wieder zu verstehen. Und wir müssen es schaffen, dass uns unsere Codes weitergegeben werden. Das ist ein Dilemma und ein Potenzial: Welches Wissen müssen wir uns anschauen und in welchen Formaten wird es eigentlich produziert?
Saboura Naqshband: Wir brauchen einen langen Atem. Es gibt Spuren, die wir suchen und welche, die wir hinterlassen müssen. Innerhalb von Europa sind wir noch relativ privilegiert, aber für diejenigen, die hier kaum Zugänge haben, wird mit Blick auf die Kontrolle von Migration und Grenzen, noch viel passieren. Auch wenn das ein extra Punkt ist: Wir brauchen Verbündete.
Protokoll: Nicola Lauré al-Samarai